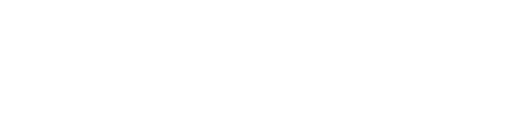
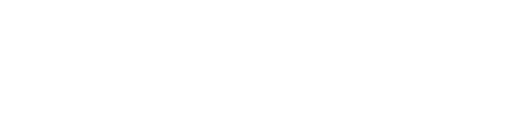
Service
allgemeine Geburtenziffer:
Bei der allgemeinen Geburtenziffer wird im Gegensatz zur rohen Geburtenziffer die Anzahl der Lebendgeborenen eines Jahres nicht auf die Gesamtbevölkerung, sondern nur auf die Zahl der Frauen im gebärfähigen Alter bezogen.
Altenquotient:
Der Altenquotient beschreibt das Verhältnis der älteren, häufig nicht mehr berufstätigen Generation (meist 65 Jahre und älter) zur Generation im erwerbsfähigen Alter (meist 20 bis unter 65 Jahre). Die Altersabgrenzungen können hierbei variieren (z. B. auch 15 und 67 Jahre).
altersspezifische Geburtenziffer:
Die altersspezifische Geburtenziffer gibt an, wie viele Kinder durchschnittlich von Frauen eines bestimmten Alters geboren werden. Sie errechnet sich aus der Zahl der Geburten der Frauen im Alter x dividiert durch die Zahl der Frauen im Alter x multipliziert mit 1.000. Die Berechnung erfolgt für alle einzelnen Altersjahre von 15 bis 49. Einflüsse, die sich aus der Größe sowie der Altersstruktur der Bevölkerung bzw. der Frauen im gebärfähigen Alter ergeben, werden damit ausgeschlossen.
Die altersspezifischen Geburtenziffern für die einzelnen Altersjahre lassen sich zusammenfassen. Die Summe aller Altersjahre ergibt die zusammengefasste Geburtenziffer.
Alterung:
Alterung im demografischen Kontext bezeichnet eine Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung hin zu einem Anstieg des Anteils älterer Bevölkerungsgruppen. Dies kann grafisch gut mit einer Bevölkerungspyramide veranschaulicht werden.
Babyboomer:
Als Babyboomer-Generation werden in Deutschland Personen bezeichnet, die in den geburtenstarken Jahrgängen Mitte der 1950er bis Ende der 1960er Jahre geboren wurden.
Bestanderhaltungsniveau:
Das Bestandserhaltungsniveau ist die durchschnittliche Kinderzahl je Frau (siehe zusammengefasste Geburtenziffer), die erforderlich wäre, um den Bevölkerungsbestand bei den gegebenen Sterblichkeitsverhältnissen konstant zu halten. Derzeit gilt ein grober Richtwert von 2,1 Geburten je Frau als Bestandserhaltungsniveau. Liegt der Wert darunter, so gleicht langfristig die Zahl der Geburten die Zahl der Sterbefälle nicht mehr aus und die Bevölkerung schrumpft. Dies ist in Deutschland seit den 1970er Jahren der Fall.
Bevölkerungsentwicklung:
Die Bevölkerung sind alle Menschen, die in einem Land leben. Die Bevölkerungsentwicklung zeigt den Anstieg bzw. Rückgang der Bevölkerungszahl innerhalb eines Zeitraumes und eines bestimmten Gebietes an und ist das Gesamtergebnis von natürlichen (Geburten, Sterbefälle) und räumlichen (Wanderungen) Bevölkerungsbewegungen.
Bevölkerungspyramide:
Die Bevölkerungspyramide ist eine grafische Darstellung des Altersaufbaus der Bevölkerung. Dabei wird in einem Koordinatensystem die Anzahl von Männern und Frauen in den einzelnen Altersgruppen dargestellt. In traditionellen Gesellschaften mit einer hohen Geburtenrate nimmt der Altersaufbau die Form einer Pyramide an – mit einem breiten Fundament Jüngerer, und zunehmend weniger Menschen in den höheren Altersgruppen. Sinkt die Geburtenrate und verbleibt unterhalb der Sterberate, so kehrt sich die Pyramide langfristig um und nimmt die Form einer Urne an. Dies ist seit vielen Jahren in den meisten Industrieländern – so auch in Deutschland – zu beobachten.
Bevölkerungsstruktur:
Bevölkerungsstruktur beschreibt die Bevölkerungszusammensetzung. Sie gliedert die Einwohner eines Gebietes nach demografischen, sozioökonomischen und ethnisch-kulturellen Merkmalen. Zu den demografischen Indikatoren zählen Altersstruktur, Geschlechtsgliederung und, eng damit verknüpft, Familienstand sowie Haushaltsstruktur. Zu den sozioökonomischen Merkmalen einer Bevölkerungsstruktur zählen Erwerbsstruktur sowie Angaben zu Lebensformen oder Siedlungsweise. Zu den ethnisch-kulturellen Merkmalen einer Bevölkerung zählen u. a. Religion, kulturelles Erbe oder gemeinsames Herkunftsgebiet, das durch die Staatsangehörigkeit erfasst werden kann.
Bevölkerungsvorausberechnung:
Mithilfe von Bevölkerungsvorausberechnungen wird die zukünftige Bevölkerungsentwicklung ermittelt. Bei Bevölkerungsvorausberechnungen werden Geburtenjahrgänge nach Geschlecht und jedes einzelne Vorausberechnungsjahr hypothetisch fortgeschrieben. Die Basis der Vorausberechnung sind getroffene Annahmen zu Geburten, Sterbefällen sowie Zu- und Fortzügen nach Alter und Geschlecht, die jeweils auf vergangenen Entwicklungen basieren. Bevölkerungsvorausberechnungen haben immer einen Stichtag (Basisjahr), von dem aus die weitere Berechnung erfolgt.
Binnenwanderung:
Als Binnenwanderung bezeichnet man Wanderungsbewegungen innerhalb einer festgelegten Region, z. B. eines Staates, Bundeslandes oder einer anderen administrativen Gebietseinheit.
Daseinsvorsorge:
Daseinsvorsorge bezeichnet die staatliche Aufgabe, Güter und Leistungen bereitzustellen, die für ein menschliches Dasein notwendig sind. Welche Güter und Leistungen als existentiell notwendig anzusehen sind, ist durch politische Aushandlungsprozesse zeitbezogen (also unter Beachtung der konkreten Rahmenbedingungen und Bedarfe) zu ermitteln. Die Daseinsvorsorge umfasst u. a. Energie- und Wasserversorgung, Bildung, Verkehrsleistungen, Telekommunikation, Rundfunk, Straßenreinigung sowie Abwasser- und Müllentsorgung.
Demografie:
Demografie befasst sich mit der Entwicklung der Bevölkerung und ihrer Strukturen. Dabei stehen folgende Faktoren im Kern des Interesses: die Geburtenrate, der Wanderungssaldo und die Sterberate. Durch diese Faktoren werden im Zeitablauf Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur, z. B. mit Blick auf die Altersstruktur oder das Geschlechterverhältnis, bestimmt.
Demografischer Wandel:
Bezeichnung für die Bevölkerungsentwicklung und ihre Veränderungen insbesondere im Hinblick auf die Altersstruktur, die Entwicklung der Geburtenzahl und der Sterbefälle, die Anteile von Inländern, Ausländern und Eingebürgerten sowie die Zuzüge und Fortzüge. In Deutschland ist der demografische Wandel dadurch gekennzeichnet, dass seit Anfang der 1970er-Jahre die Geburtenrate deutlich unter dem bestandserhaltenden Niveau liegt, das für eine stabile Bevölkerungszahl ohne Berücksichtigung von Wanderungsbewegungen notwendig wäre. Ein weiteres Kennzeichen ist die höhere Lebenserwartung der Bevölkerung, was bei zurückgehender Geburtenrate zu einem größeren Anteil der älteren Bevölkerung im Vergleich zum Anteil der jüngeren Bevölkerung führt. Zusätzlich ist die Bevölkerung in Deutschland aufgrund regelmäßiger Wanderungsgewinne gegenüber dem Ausland in den vergangenen Jahrzehnten deutlich internationaler geworden, das heißt, es leben mehr Menschen mit Migrationshintergrund bzw. ausländischer Staatsangehörigkeit in Deutschland.
Durchschnittsalter:
Das Durchschnittsalter beschreibt das errechnete durchschnittliche Lebensalter eines definierten Personenkreises – z. B. der Thüringer Bevölkerung oder der Bevölkerung Deutschlands – als arithmetisches Mittel des Alters aller Personen dieses Personenkreises zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Fertilität (bzw. Fruchtbarkeit):
Fertilität beschreibt die Geburtenzahl einer Person, Gruppe oder einer Bevölkerung in einer bestimmten Periode. Die Fertilität ist neben der Sterblichkeit und dem Wanderungsverhalten der zentrale Faktor der Bevölkerungsentwicklung. Berechnet wird die Fertilität beispielsweise an Hand der Fertilitätsrate bzw. der zusammengefassten Geburtenziffer.
Fertilitätsrate:
Die allgemeine Fertilitätsrate oder auch Fruchtbarkeitsrate gibt die Zahl der Lebendgeburten je 1.000 Frauen der Altersgruppe 15 bis 49 Jahre (alternativ auch 15 bis 44 Jahre) in einem Jahr an. Die Fertilitätsrate wird stark durch die Altersstruktur der Frauen im Alter von 15 bis 49 Jahren beeinflusst, da die Wahrscheinlichkeit für eine Geburt in den verschiedenen Altersstufen sehr unterschiedlich ist.
Geburtendefizit (bzw. Sterbefallüberschuss):
Geburtendefizit bedeutet, dass in einer Region (z. B. Staat oder Bundesland) in einem bestimmten Zeitraum die Zahl der Lebendgeborenen geringer ausfällt als die Zahl der Sterbefälle.
Generationenvertrag:
Mit Generationenvertrag wird der unausgesprochene, nicht schriftlich fixierte Vertrag zwischen der beitragszahlenden und der rentenempfangenden Generation bezeichnet. Der Generationenvertrag ist die theoretische Grundlage für eine nach dem Umlageverfahren finanzierte Rentenversicherung. Die im Generationenvertrag enthaltene Solidarität zwischen den Generationen umfasst die Verpflichtung der arbeitenden Generation zur Beitragszahlung in der Erwartung, dass für die eigene Rente die ihr nachfolgende Generation die gleiche Verpflichtung übernimmt.
Gesellschaft:
Als Gesellschaft wird in der Soziologie eine durch unterschiedliche Merkmale zusammengefasste und abgegrenzte Anzahl von Personen, die miteinander verknüpft leben und direkt oder indirekt sozial interagieren, bezeichnet. Gesellschaft bezieht sich sowohl auf die Menschheit als ganze (gegenüber Tieren und Pflanzen) als auch auf bestimmte Gruppen von Menschen, beispielsweise auf ein Volk oder eine Nation.
Heterogenisierung:
Im Zuge der Individualisierung – verbunden mit geringeren materiellen Abhängigkeiten, veränderten Rollenbildern etc. – sind sowohl die Formen des Zusammenlebens als auch die individuellen Lebensentwürfe vielfältiger geworden und gesellschaftlich anerkannt (Singlehaushalte, Patchwork-Familien, Paare ohne Kinder etc.).
Individualisierung:
Der Begriff der Individualisierung stammt aus der Soziologie und bezeichnet einen mit der Renaissance und der Aufklärung einsetzenden, mit der Industrialisierung und Modernisierung der westlichen Gesellschaften fortschreitenden Prozess eines Übergangs des Individuums von der Fremd- zur Selbstbestimmung. Zunehmender Wohlstand hat diesen Prozess befördert. In Zusammenhang mit der Alterung der Bevölkerung und eines Rückgangs der Geburtenrate führt dies zu einer Verringerung der durchschnittlichen Haushaltsgröße.
Infrastruktur:
Infrastruktur beinhaltet alle staatlichen und privaten Einrichtungen, die für eine ausreichende Daseinsvorsorge und wirtschaftliche Entwicklung als erforderlich gelten. Die Infrastruktur wird meist unterteilt in technische Infrastruktur (z. B. Einrichtungen der Verkehrs- und Nachrichtenübermittlung, der Energie- und Wasserversorgung, der Entsorgung) und soziale Infrastruktur (z. B. Schulen, Krankenhäuser, Sport- und Freizeitanlagen, Einkaufsstätten, kulturelle Einrichtungen).
Internationalisierung:
Der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund in unserer Gesellschaft nimmt infolge der Zuwanderung aus dem Ausland zu. Damit wird die Gesellschaft immer „bunter“ und auch die kulturelle und ethnische Vielfalt steigt. Dadurch erhöht sich auch der Bedarf an Integrationsleistungen.
Lebenserwartung:
Die durchschnittliche Lebenserwartung gibt an, wie viele Jahre ein Mensch unter den gegenwärtigen Sterblichkeitsverhältnissen im Durchschnitt noch zu leben hat. Mit zunehmenden Alter erhöht sich die durchschnittliche Lebenserwartung eines Menschen („fernere Lebenserwartung“), einerseits indem das Sterberisiko der bereits durchlebten Jahre entfällt und andererseits durch die Veränderung der Sterblichkeitsverhältnisse im Zeitverlauf. Berechnet wird die durchschnittliche Lebenserwartung mit Hilfe von Sterbetafeln. In den vergangenen Jahrzehnten ist die Lebenserwartung bei Geburt kontinuierlich gestiegen. Ursache hierfür sind beispielsweise u. a. ein höheres Einkommen, medizinisch-technischer Fortschritt bzw. ein gesünderer Lebensstil.
Medianalter:
Das Medianalter teilt die Bevölkerung nach dem Alter in zwei gleich große Gruppen: 50 Prozent sind jünger und 50 Prozent sind älter als das Medianalter. Im Zusammenhang mit der Alterung der Bevölkerung steigt das Medianalter kontinuierlich an.
Migration (bzw. Wanderung):
Als Migration bezeichnet man im demografischen Kontext eine dauerhafte bzw. temporäre Wohnsitzveränderung von Personen.
Migrationshintergrund:
Eine Person hat einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde. Im Einzelnen umfasst diese Definition zugewanderte und nicht zugewanderte Ausländerinnen und Ausländer, zugewanderte und nicht zugewanderte Eingebürgerte, (Spät-) Aussiedlerinnen und (Spät-) Aussiedler sowie die als Deutsche geborenen Nachkommen dieser Gruppen.
Die Vertriebenen des Zweiten Weltkrieges haben (gemäß Bundesvertriebenengesetz) einen gesonderten Status; sie und ihre Nachkommen zählen daher nicht zur Bevölkerung mit Migrationshintergrund.
Mikrozensus:
Der Mikrozensus ist eine seit 1957 in Deutschland durchgeführte repräsentative Haushaltsbefragung des Statistischen Bundesamts und der Statistischen Landesämter, an der jährlich 1 % aller Haushalte in Deutschland teilnehmen. Die jeweils über vier Jahre hinweg befragten Haushalte werden nach bestimmten Zufallskriterien ausgewählt. Der Mikrozensus dient der Bereitstellung statistischer Informationen über die wirtschaftliche und soziale Lage der Bevölkerung sowie über Erwerbstätigkeit und Ausbildung.
Mortalität (bzw. Sterblichkeit):
Mortalität ist definiert als Anzahl der Todesfälle im Verhältnis zur Bevölkerung. Sie kann für die Gesamtbevölkerung, aber auch für einzelne Altersgruppen oder getrennt für Männer und Frauen angegeben werden. Sie wird durch Sterbeziffern oder Sterberaten ausgedrückt.
Die Mortalität wird von verschiedenen biologischen, medizinischen und sozioökonomischen Faktoren beeinflusst. Hinzu kommt noch die individuelle Lebensweise, die sich ebenfalls auf die Sterberate auswirkt.
Renteneintrittsalter:
Das gesetzliche Renteneintrittsalter ist das Alter, ab dem eine Person die Erwerbstätigkeit beenden (politische Festlegung) und aus der gesetzlichen Rentenversicherung ohne Abschläge eine Rente beziehen kann. Das tatsächliche Renteneintrittsalter ist dagegen das Alter, in welchem die Personen tatsächlich in Rente gehen, es liegt meist unter dem gesetzlichen Renteneintrittsalter. Ursache hierfür sind z. B. großzügige Frühverrentungsregelungen.
Wanderungssaldo:
Als Wanderungssaldo oder Wanderungsbilanz wird die Differenz zwischen Abwanderung und Zuwanderung bezeichnet, also der Zahl der Zuzüge und der Zahl der Fortzüge für eine konkrete Region und einen bestimmten Zeitraum. Wenn mehr Menschen zuwandern als abwandern, dann ist der Wanderungssaldo positiv und man spricht von einem Wanderungsüberschuss bzw. Wanderungsgewinn. Im entgegengesetzten Fall liegt ein Wanderungsdefizit bzw. Wanderungsverlust vor.
Zensus:
Ein Zensus ist eine Volkszählung. Dabei geht es aber nicht nur darum, zu erfahren, wie viele Menschen genau im Land leben. Der Zensus soll auch Informationen über die Wohn- und Arbeitssituation der Menschen liefern. Der letzte Zensus wurde auf Grundlage des Zensusgesetzes 2022 (ZensG 2022) durchgeführt.
Eine Vielzahl an Entscheidungen in Bund, Ländern und Gemeinden beruhen auf aktuellen Bevölkerungs- und Wohnungszahlen. Um verlässliche Basiszahlen für Planungen zu haben, ist eine regelmäßige Bestandsaufnahme der Bevölkerungszahl notwendig.
Zusammengefasste Geburtenziffer:
Die zusammengefasste Geburtenziffer gibt die durchschnittliche Anzahl von Kindern an, die eine Frau im Laufe ihres Lebens hätte, wenn für deren ganzes Leben die altersspezifischen Geburtenziffern des jeweils betrachteten Kalenderjahres gelten würden. Sie wird berechnet, indem die altersspezifischen Geburtenhäufigkeiten des beobachteten Jahres für die Frauen im Alter von 15 bis 49 Jahren addiert werden. Die zusammengefasste Geburtenziffer ist, im Gegensatz zur Fertilitätsrate, frei vom Einfluss der jeweiligen Altersstruktur der weiblichen Bevölkerung.
Die zusammengefasste Geburtenziffer ist die am häufigsten verwendete Kennziffer zur Charakterisierung des aktuellen Geburtenniveaus, weil die tatsächlichen durchschnittlichen Geburtenzahlen je Frau erst dann festgestellt werden können, wenn die Frauen das gesamte gebärfähige Alter durchlaufen haben.
Quellen:
Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung
Max-Planck-Institut für demografische Forschung
Bundeszentrale für politische Bildung
Statistischen Bundesamt (Destatis)
Thüringer Landesamt für Statistik (TLS)